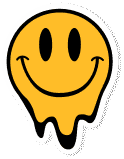Design als Akt der Demut
👁 1549 |
| 2025-01
KI als Zerrspiegel unserer Annahmen
Die kreative Arbeit mit generativer KI ähnelt einem Gespräch mit einem scharfsinnigen Fremden: Sie stellt unsere Gewohnheiten infrage, fordert uns heraus und eröffnet uns neue Perspektiven dadurch.
Wie Jacques Carelmans Catalogue of Impossible Objects – eine Sammlung absurd-nutzloser Entwürfe wie ein Fahrrad mit rechteckigen Rädern – kann uns generative KI mit Objekten oder Konzepten konfrontieren, die sich unseren Erwartungen entziehen.
Wenn wir sie auffordern ein Bild von einen üblichen Holzstuhl mit nur einem Bein zu generieren, wird schnell offensichtlich, wie wir an Normen wie „vier Beine = Stabilität“ gebunden sind. Ein Stuhl mit nur einem Bein oder eine Architektur aus lebendigem Myzel, sind hier allerdings keine Fehler, sondern Provokationen. Carelmans unmögliche Objekte, ebenso wie KI generierte Objekte oder Konzepte werfen Fragen auf: Warum akzeptieren wir bestimmte Formen und Ideen als „logisch“?
Der Spiegel lügt nicht. Er spiegelt, was unsichtbar blieb: dass selbst revolutionäre Entwürfe oft nur Variationen bekannter Muster sind. KI und Carelman lehren uns das Gleiche: Um Neues zu schaffen, müssen wir erst lernen, das scheinbar Unmögliche ernst zu nehmen – nicht als Störung, sondern als Einladung, unsere Denkblasen zu durchstechen.
Kreativität neu denken: Von Zufällen und Stillstand
Arthur Koestler beschrieb Kreativität als „Bisoziation“ – den Blitzschlag zwischen unverbundenen Ideen. KI kann sehr gute Bedingungen für solche „Blitz“ Interaktionen ermöglichen – indem visuell oder konzeptionell Dinge verbunden werden, die wir so nicht miteinander zusammenbringen würden.
Damit eine KI positiv auf die Kreativität wirkt, muss sie menschliche Denkmuster spiegeln und brechen: Sie sollte nicht nur Assoziationen beschleunigen, sondern auch Leerstellen schaffen – etwa durch zufällige Unterbrechungen oder das Einfordern von Reflexionspausen. Neurowissenschaftler:innen wie John Kounios zeigen, dass „Aha-Momente“ oft im Nichtstun entstehen, wenn das Gehirn vom fokussierten Denken in den Ruhemodus wechselt.
Echte Kollaboration entsteht, wenn KI als „Provokations-Tool“ dient: Sie liefert keine Lösungen, sondern zwingt uns, scheinbar widersprüchliche Konzepte auszuhalten („Ein Stuhl als Wolke?“). Erst wenn wir diese Ambivalenz aushalten – ähnlich Koestlers Theorie der „kreativen Spannung“ –, entsteht Raum für Neues. Es geht nicht um Effizienz, sondern darum, den Kontrollverlust zu kultivieren: Nur wer bereit ist, ins Unlogische abzudriften, entdeckt, warum ein Tisch auch eine Frage sein könnte.
KI als Brückenbauer zwischen Welten
Donna Haraway beschrieb in ihrem „Cyborg Manifesto“ eine Zukunft, in der Mensch und Maschine verschmelzen – heute erleben wir das in Beobachtungen unsers Alltags mit digitalen Geräten, Alorithmen und KI. Dies wirkt auch schon längst in alle kreativen Prozesse hinein.
Stellen Sie sich vor: Eine Architektin und eine Biologin entwickeln mit KI ein Gebäude, das wie ein Pilzgeflecht ausgeformt ist und „lebt“. Die KI übersetzt biologische Fachbegriffe und Bedingtheiten, sodaß die GestalterInnen draus plausible 3D-Strukturen entwickeln koennen – ähnlich wie eine DolmetscherIn, die nicht nur Worte, sondern ganze Welten vermittelt – zwischen den Disziplinen. Die Biologin kann wiederum aus den gestalteten Formen konkretes Feedback entwickeln und im direkten Austausch über den Mittler KI, ein sehr agiles Gestaltern ermöglichen.
Buckminster Fuller träumte von solchen Kollaborationen, um globale Probleme zu lösen. Doch während Fuller noch an recht komplexe Modelle und Interaktionen dachte, genügt heute für erste ein Textprompt: „Entwirf eine Archtitektur, die aus Moos und Myzel besteht und fortlaufend evolviert.“
Vom KI-Bias zum Selbst-Check: Wo sitzen unsere Denkblasen?
Genau wie wir KI-Systeme auf Vorurteile prüfen, müssen wir uns selbst befragen. Nehmen wir das Konzept des „Genies“: Seit der Renaissance feiern wir den einsamen Schöpfer (Michelangelo unter der Sixtinischen Kapelle!), obwohl Kreativität immer ein kollektiver Akt ist. KI entlarvt das: Jede ihrer „Ideen“ ist ein Mashup aus Millionen Quellen. Jedes neue Idee wächst auf unzähligen alten Ideen, verborgenen Inspirationen, vergessenen Fehlschlägen.
Hier schließt sich der Kreis zur Philosophie Timothy Mortons („Hyperobjects“): Wir sind Teil eines riesigen, unsichtbaren Netzes aus Einflüssen. Wenn KI uns zeigt, wie sehr selbst unsere „Originalität“ auf fremden Daten beruht, müssen wir auch unsere Rolle neu denken: Jeder Mensch ist Designer, ob bewusst oder nicht. Der Barista, der den Milchschaum kunstvoll arrangiert? Die/der HobbygaertnerIn, der/die den Gemüsegarten anlegt? Alles Gestaltung.
Koestlers „Bisoziation“ aus The Act of Creation (1964)
John Kounios‘ Forschung zu kreativen „Insight“-Momenten (Drexel University)
Design als Akt der Demut
Victor Papanek forderte eine Ethik der Bescheidenheit. Aus dieser Perspektive sollten wir generative KI nicht als Allmachtswerkzeug, sondern als kritischen Partner betrachten.
Mit Hilfe von generativer KI können wir schneller und umfassender zu alternativen Entwürfen und Ideen gelangen – wie die lebendigen Architekturen aus Moos und Myzel. Wir können uns durch generative KI auf interdisziplinärer Ebene kreativ mit Anderen enger verbinden. Wir kuratieren, leiten und werden geleitet von diesem Prozess.
Statt Designer:innen als alleinige Schöpfer:innen zu sehen, werden sie zu Gärtner:innen: Sie pflanzen gemeinsame Ideen, lassen durch KI unerwartete Variationen entstehen, ordnen diese ein und evolvieren.
KI kann uns helfen in hohem Grad zu präzisen, komplexen Lösungen zu gelagen – KI führt uns aber auch ins Ungewisse, indem sie Zufälle, Widersprüche oder scheinbar „nutzlose“ Konzepte einbringt – gerade darin liegt das große kreatives Potenzial, das nur durch den Menschen hervorgebracht werden kann.
Dies fordert eine Form des Demut vor dem Gestaltungsprozess mit KI: Nicht wir bestimmen, was „gutes Design“ ist, sondern lernen, mit Ambivalenz zu arbeiten und Lösungen zu kultivieren, die unsere eigenen Annahmen hinterfragen.
Entschleunigung als gezielte Provokation
Bayo Akomolafes Frage nach dem „Langsamerwerden“ zielt nicht auf Trägheit ab, sondern auf eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem eigenen kreativen Kern. KI kann hier unterstützen, indem sie Designer:innen nicht blind beschleunigt, sondern gezielt in ihren Stärken herausfordert – etwa durch Prompts wie: „Skizziere 10 Varianten dieses Stuhls, die alle das Gegenteil von Stabilität feiern“ oder „Verbinde diese Architekturidee mit einem Songtext aus den 1980ern“.
Entschleunigung bedeutet hier: KI optimiert nicht den Output, sondern die Qualität der menschlichen Entscheidungsmomente. Sie provoziert Designer:innen , ihre Expertise (Skizzieren, Bewerten, Vernetzen) radikaler einzusetzen – etwa indem sie unerwartete Hybridkonzepte generiert (z. B. einen Stuhl, der gleichzeitig eine Klangskulptur ist), die der Mensch dann filtern, bewerten und verfeinern muss.
Akomolafes Vision trifft sich mit Tim Ingolds Idee des „Wanderns statt Navigierens“: KI könnte als „kreativer Wanderführer“ fungieren, der Pfade vorschlägt, aber das Tempo und die Richtung der Reise dem Menschen überlässt. So wird Entschleunigung zur Optimierung des intentionalen Handelns: Die KI stört nicht sinnlos, sondern schärft den Fokus auf das, was Designer:innen wirklich können – nämlich im Chaos der Optionen meaningful connections herstellen, die Maschinen nie vollends verstehen werden.
Spekulatives Design als politischer Akt
In einer Welt, die durch KI und Tech-Entwicklungen im Stundentakt umgepflügt wird, ist spekulatives Design keine Spielerei, sondern ein Werkzeug zur Navigationshilfe im Ungewissen. Projekte wie „The Institute of Human Obsolescence“ – das absurde Zukunftsberufe wie den „Emotionsmüllmann“ erdachte – zeigen: Fiktionen sind keine Flucht, sondern ein Testlauf für mögliche Realitäten. Sie zwingen uns, heutige Entscheidungen anhand von morgen möglichen Konsequenzen zu überprüfen.
Warum ist das nötig? Weil der rasante Wandel durch KI oft zu passiver Reaktion verleitet: Wir reparieren Probleme, statt sie vorauszudenken. Spekulatives Design dreht den Spieß um: Indem es radikale Szenarien wie datenverkaufende „Datenkörper“ entwirft, enttarnt es heutige Machtstrukturen (Wer profitiert von Automation?) und schafft Debatten bevor Tech-Unternehmen Fakten schaffen. Es ist ein politischer Akt, weil es Alternativen sichtbar macht – etwa zum bedingungslosen Grundeinkommen – und so demokratische Aushandlung erzwingt.
Fiktion wird hier zum Kompass: Sie übersetzt abstrakte Tech-Trends in greifbare Geschichten, an denen sich Gesellschaften orientieren können. Designer:innen werden zu Architekt:innen des Möglichen – nicht um die Zukunft vorherzusagen, sondern um sie mitgestaltbar zu halten. Denn nur wer sich dystopische Arbeitswelten ausmalt, kann heute verhindern, dass sie Realität werden.
Ideen für weitere Absätze
Posthumanes Design: Was passiert, wenn KI nicht für Menschen, sondern mit Ökosystemen „kollaboriert“?
Das Ende des Geniekults: Wie KI-Teams demokratisieren kann – Beispiele aus Open-Source-Communities.
Quellen
- Anthony Dunne & Fiona Raby – „Speculative Everything“ – ISBN: 978-0262019842
- Donna Haraway – „A Cyborg Manifesto“ – Onlinequelle
- Buckminster Fuller – Utopien zu interdisziplinären Kollaborationen – Onlinequelle
- Tony Fry – „Design Futuring“ – ISBN: 978-1847886361
- Arthur Koestler – „The Act of Creation“ – ISBN: 978-0140191917
- Bruce Sterling – „Design Fiction“ – Onlinequelle
- Timothy Morton – „Hyperobjects“ – ISBN: 978-0816691247
- Victor Papanek – „Design for the Real World“ – ISBN: 978-0500273586
- Bayo Akomolafe – Philosoph der Postactivism-Bewegung – Onlinequelle
- Jacques Carelman – „Catalogue of Impossible Objects“ – ISBN: 978-0876633129
- John Kounios – Forschung zu kreativen „Aha-Momenten“ – Onlinequelle
- Tim Ingold – „Wandern statt Navigieren“ – Onlinequelle
- Theaster Gates – Zitat: „Manchmal ist das beste Design, ein Gebäude nicht abzureißen.“ – Onlinequelle
- The Institute of Human Obsolescence – Projekt: Spekulative Zukunftsberufe – Onlinequelle
KI als Zerrspiegel unserer Annahmen
Die kreative Arbeit mit generativer KI ähnelt einem Gespräch mit einem scharfsinnigen Fremden: Sie stellt unsere Gewohnheiten infrage, fordert uns heraus und eröffnet uns neue Perspektiven dadurch.
Wie Jacques Carelmans Catalogue of Impossible Objects – eine Sammlung absurd-nutzloser Entwürfe wie ein Fahrrad mit rechteckigen Rädern – kann uns generative KI mit Objekten oder Konzepten konfrontieren, die sich unseren Erwartungen entziehen.
Wenn wir sie auffordern ein Bild von einen üblichen Holzstuhl mit nur einem Bein zu generieren, wird schnell offensichtlich, wie wir an Normen wie „vier Beine = Stabilität“ gebunden sind. Ein Stuhl mit nur einem Bein oder eine Architektur aus lebendigem Myzel, sind hier allerdings keine Fehler, sondern Provokationen. Carelmans unmögliche Objekte, ebenso wie KI generierte Objekte oder Konzepte werfen Fragen auf: Warum akzeptieren wir bestimmte Formen und Ideen als „logisch“?
Der Spiegel lügt nicht. Er spiegelt, was unsichtbar blieb: dass selbst revolutionäre Entwürfe oft nur Variationen bekannter Muster sind. KI und Carelman lehren uns das Gleiche: Um Neues zu schaffen, müssen wir erst lernen, das scheinbar Unmögliche ernst zu nehmen – nicht als Störung, sondern als Einladung, unsere Denkblasen zu durchstechen.
Kreativität neu denken: Von Zufällen und Stillstand
Arthur Koestler beschrieb Kreativität als „Bisoziation“ – den Blitzschlag zwischen unverbundenen Ideen. KI kann sehr gute Bedingungen für solche „Blitz“ Interaktionen ermöglichen – indem visuell oder konzeptionell Dinge verbunden werden, die wir so nicht miteinander zusammenbringen würden.
Damit eine KI positiv auf die Kreativität wirkt, muss sie menschliche Denkmuster spiegeln und brechen: Sie sollte nicht nur Assoziationen beschleunigen, sondern auch Leerstellen schaffen – etwa durch zufällige Unterbrechungen oder das Einfordern von Reflexionspausen. Neurowissenschaftler:innen wie John Kounios zeigen, dass „Aha-Momente“ oft im Nichtstun entstehen, wenn das Gehirn vom fokussierten Denken in den Ruhemodus wechselt.
Echte Kollaboration entsteht, wenn KI als „Provokations-Tool“ dient: Sie liefert keine Lösungen, sondern zwingt uns, scheinbar widersprüchliche Konzepte auszuhalten („Ein Stuhl als Wolke?“). Erst wenn wir diese Ambivalenz aushalten – ähnlich Koestlers Theorie der „kreativen Spannung“ –, entsteht Raum für Neues. Es geht nicht um Effizienz, sondern darum, den Kontrollverlust zu kultivieren: Nur wer bereit ist, ins Unlogische abzudriften, entdeckt, warum ein Tisch auch eine Frage sein könnte.
KI als Brückenbauer zwischen Welten
Donna Haraway beschrieb in ihrem „Cyborg Manifesto“ eine Zukunft, in der Mensch und Maschine verschmelzen – heute erleben wir das in Beobachtungen unsers Alltags mit digitalen Geräten, Alorithmen und KI. Dies wirkt auch schon längst in alle kreativen Prozesse hinein.
Stellen Sie sich vor: Eine Architektin und eine Biologin entwickeln mit KI ein Gebäude, das wie ein Pilzgeflecht ausgeformt ist und „lebt“. Die KI übersetzt biologische Fachbegriffe und Bedingtheiten, sodaß die GestalterInnen draus plausible 3D-Strukturen entwickeln koennen – ähnlich wie eine DolmetscherIn, die nicht nur Worte, sondern ganze Welten vermittelt – zwischen den Disziplinen. Die Biologin kann wiederum aus den gestalteten Formen konkretes Feedback entwickeln und im direkten Austausch über den Mittler KI, ein sehr agiles Gestaltern ermöglichen.
Buckminster Fuller träumte von solchen Kollaborationen, um globale Probleme zu lösen. Doch während Fuller noch an recht komplexe Modelle und Interaktionen dachte, genügt heute für erste ein Textprompt: „Entwirf eine Archtitektur, die aus Moos und Myzel besteht und fortlaufend evolviert.“
Vom KI-Bias zum Selbst-Check: Wo sitzen unsere Denkblasen?
Genau wie wir KI-Systeme auf Vorurteile prüfen, müssen wir uns selbst befragen. Nehmen wir das Konzept des „Genies“: Seit der Renaissance feiern wir den einsamen Schöpfer (Michelangelo unter der Sixtinischen Kapelle!), obwohl Kreativität immer ein kollektiver Akt ist. KI entlarvt das: Jede ihrer „Ideen“ ist ein Mashup aus Millionen Quellen. Jedes neue Idee wächst auf unzähligen alten Ideen, verborgenen Inspirationen, vergessenen Fehlschlägen.
Hier schließt sich der Kreis zur Philosophie Timothy Mortons („Hyperobjects“): Wir sind Teil eines riesigen, unsichtbaren Netzes aus Einflüssen. Wenn KI uns zeigt, wie sehr selbst unsere „Originalität“ auf fremden Daten beruht, müssen wir auch unsere Rolle neu denken: Jeder Mensch ist Designer, ob bewusst oder nicht. Der Barista, der den Milchschaum kunstvoll arrangiert? Die/der HobbygaertnerIn, der/die den Gemüsegarten anlegt? Alles Gestaltung.
Design als Akt der Demut
Victor Papanek forderte eine Ethik der Bescheidenheit. Aus dieser Perspektive sollten wir generative KI nicht als Allmachtswerkzeug, sondern als kritischen Partner betrachten.
Mit Hilfe von generativer KI können wir schneller und umfassender zu alternativen Entwürfen und Ideen gelangen – wie die lebendigen Architekturen aus Moos und Myzel. Wir können uns durch generative KI auf interdisziplinärer Ebene kreativ mit Anderen enger verbinden. Wir kuratieren, leiten und werden geleitet von diesem Prozess.
Statt Designer:innen als alleinige Schöpfer:innen zu sehen, werden sie zu Gärtner:innen: Sie pflanzen gemeinsame Ideen, lassen durch KI unerwartete Variationen entstehen, ordnen diese ein und evolvieren.
KI kann uns helfen in hohem Grad zu präzisen, komplexen Lösungen zu gelagen – KI führt uns aber auch ins Ungewisse, indem sie Zufälle, Widersprüche oder scheinbar „nutzlose“ Konzepte einbringt – gerade darin liegt das große kreatives Potenzial, das nur durch den Menschen hervorgebracht werden kann.
Dies fordert eine Form des Demut vor dem Gestaltungsprozess mit KI: Nicht wir bestimmen, was „gutes Design“ ist, sondern lernen, mit Ambivalenz zu arbeiten und Lösungen zu kultivieren, die unsere eigenen Annahmen hinterfragen.
Entschleunigung als gezielte Provokation
Bayo Akomolafes Frage nach dem „Langsamerwerden“ zielt nicht auf Trägheit ab, sondern auf eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem eigenen kreativen Kern. KI kann hier unterstützen, indem sie Designer:innen nicht blind beschleunigt, sondern gezielt in ihren Stärken herausfordert – etwa durch Prompts wie: „Skizziere 10 Varianten dieses Stuhls, die alle das Gegenteil von Stabilität feiern“ oder „Verbinde diese Architekturidee mit einem Songtext aus den 1980ern“.
Entschleunigung bedeutet hier: KI optimiert nicht den Output, sondern die Qualität der menschlichen Entscheidungsmomente. Sie provoziert Designer:innen , ihre Expertise (Skizzieren, Bewerten, Vernetzen) radikaler einzusetzen – etwa indem sie unerwartete Hybridkonzepte generiert (z. B. einen Stuhl, der gleichzeitig eine Klangskulptur ist), die der Mensch dann filtern, bewerten und verfeinern muss.
Akomolafes Vision trifft sich mit Tim Ingolds Idee des „Wanderns statt Navigierens“: KI könnte als „kreativer Wanderführer“ fungieren, der Pfade vorschlägt, aber das Tempo und die Richtung der Reise dem Menschen überlässt. So wird Entschleunigung zur Optimierung des intentionalen Handelns: Die KI stört nicht sinnlos, sondern schärft den Fokus auf das, was Designer:innen wirklich können – nämlich im Chaos der Optionen meaningful connections herstellen, die Maschinen nie vollends verstehen werden.
Spekulatives Design als politischer Akt
In einer Welt, die durch KI und Tech-Entwicklungen im Stundentakt umgepflügt wird, ist spekulatives Design keine Spielerei, sondern ein Werkzeug zur Navigationshilfe im Ungewissen. Projekte wie „The Institute of Human Obsolescence“ – das absurde Zukunftsberufe wie den „Emotionsmüllmann“ erdachte – zeigen: Fiktionen sind keine Flucht, sondern ein Testlauf für mögliche Realitäten. Sie zwingen uns, heutige Entscheidungen anhand von morgen möglichen Konsequenzen zu überprüfen.
Warum ist das nötig? Weil der rasante Wandel durch KI oft zu passiver Reaktion verleitet: Wir reparieren Probleme, statt sie vorauszudenken. Spekulatives Design dreht den Spieß um: Indem es radikale Szenarien wie datenverkaufende „Datenkörper“ entwirft, enttarnt es heutige Machtstrukturen (Wer profitiert von Automation?) und schafft Debatten bevor Tech-Unternehmen Fakten schaffen. Es ist ein politischer Akt, weil es Alternativen sichtbar macht – etwa zum bedingungslosen Grundeinkommen – und so demokratische Aushandlung erzwingt.
Fiktion wird hier zum Kompass: Sie übersetzt abstrakte Tech-Trends in greifbare Geschichten, an denen sich Gesellschaften orientieren können. Designer:innen werden zu Architekt:innen des Möglichen – nicht um die Zukunft vorherzusagen, sondern um sie mitgestaltbar zu halten. Denn nur wer sich dystopische Arbeitswelten ausmalt, kann heute verhindern, dass sie Realität werden.
Ideen für weitere Absätze
Posthumanes Design: Was passiert, wenn KI nicht für Menschen, sondern mit Ökosystemen „kollaboriert“?
Das Ende des Geniekults: Wie KI-Teams demokratisieren kann – Beispiele aus Open-Source-Communities.
Quellen
- Anthony Dunne & Fiona Raby – „Speculative Everything“ – ISBN: 978-0262019842
- Donna Haraway – „A Cyborg Manifesto“ – Onlinequelle
- Buckminster Fuller – Utopien zu interdisziplinären Kollaborationen – Onlinequelle
- Tony Fry – „Design Futuring“ – ISBN: 978-1847886361
- Arthur Koestler – „The Act of Creation“ – ISBN: 978-0140191917
- Bruce Sterling – „Design Fiction“ – Onlinequelle
- Timothy Morton – „Hyperobjects“ – ISBN: 978-0816691247
- Victor Papanek – „Design for the Real World“ – ISBN: 978-0500273586
- Bayo Akomolafe – Philosoph der Postactivism-Bewegung – Onlinequelle
- Jacques Carelman – „Catalogue of Impossible Objects“ – ISBN: 978-0876633129
- John Kounios – Forschung zu kreativen „Aha-Momenten“ – Onlinequelle
- Tim Ingold – „Wandern statt Navigieren“ – Onlinequelle
- Theaster Gates – Zitat: „Manchmal ist das beste Design, ein Gebäude nicht abzureißen.“ – Onlinequelle
- The Institute of Human Obsolescence – Projekt: Spekulative Zukunftsberufe – Onlinequelle